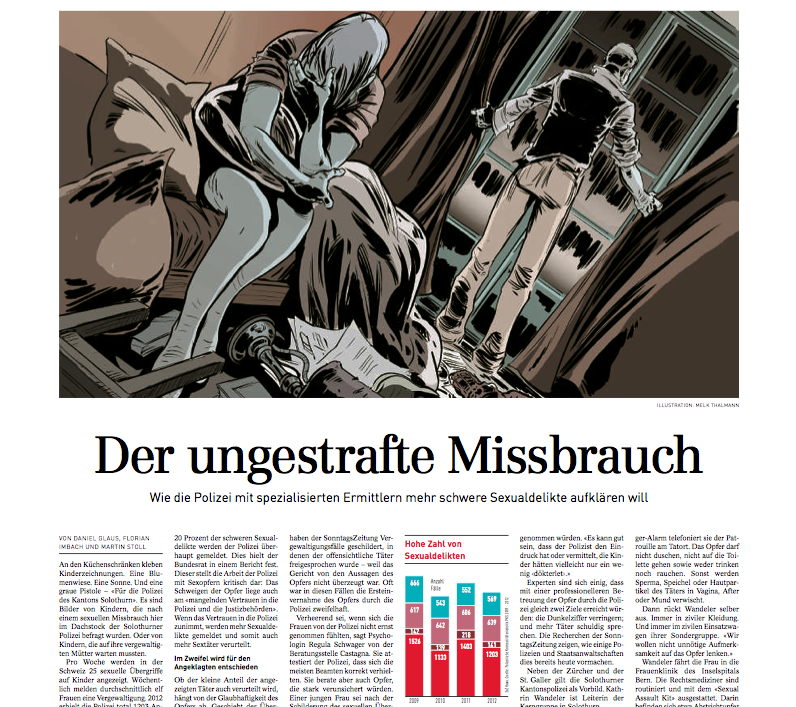Erschienen am 6. November 2013 auf www.investigativ.ch
Von Florian Imbach
Die Universität Zürich hat in einer grossangelegten Rasterfahndung mit der Staatsanwaltschaft Zürich kooperiert, wie der Tages-Anzeiger berichtet hat. Die Universität lieferte Daten Dutzender Mitarbeiter, die in Kontakt mit Medien standen. Der genaue Ablauf der Spähaktion ist noch unklar. Was sicher ist: Um die «verdächtigen» Mitarbeiter zu identifizieren, durchsuchte entweder die Staatsanwaltschaft oder die Universität Mail-Konti und Dokumente Tausender Bürger. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Staatsanwaltschaft zusätzlich zahlreiche Telefonverbindungsdaten überprüfte.
Der Eingriff der Zürcher Staatsmacht erfolgte im Rahmen einer Ermittlung wegen Amtsgeheimnisverletzung. Es wird vermutet, dass einer der rund 8000 Mitarbeiter der Universität Zürich Dokumente an einen Journalisten weitergab. Staatsanwaltschaften in der Schweiz scheinen jegliche professionelle Distanz verloren zu haben, wenn es um Amtsgeheimnisverletzung geht. Dabei ist ihnen offenbar jedes Mittel recht. In Neuenburg liess die Staatsanwaltschaft erst kürzlich in einem ähnlichen Fall gar das Haus eines Journalisten durchsuchen und dessen Computer beschlagnahmen. Das zuständige Kantonsgericht beurteilte die Aktion als illegal. Demnächst wird die Aktion vor Bundesgericht verhandelt.
Der ETH-Soziologie-Professor Dirk Helbing hat sich am 5. November im Tages-Anzeiger zur Affäre Uni Zürich geäussert (Artikel nicht online). Er schreibt, die Schweiz sei mittlerweile an einem bedenklichen Punkt angelangt: «An einem Punkt, wo Fahndungsmethoden zur Ermittlung von Terroristen und Schwerverbrechern – die Rasterfahndung – auf Tatbestände angewendet werden, bei denen keinerlei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vorliegt.» Helbing warnt vor einer schleichenden Entwicklung hin zu einem totalitären System, wo Bürger wie «gut geölte Rädchen in einem Getriebe funktionieren». Niemand wage mehr, sich quer zu stellen.
Die mittel- und langfristigen Folgen der Uni-Rasterfahndung als Beispiel eines grassierenden «Law and order»-Trends, wie ihn Helbing beschreibt, sind ernst zu nehmen. Journalistinnen und Journalisten beschäftigen sich dieser Tage mit den unmittelbaren und praktischen Folgen für ihre Arbeit. Für viele ist klar: Mit solchen Aktionen werden jene stigmatisiert, die Kontakte zu Journalisten pflegen.
– Der alltägliche Austausch mit Journalisten wird angeprangert. Der Eindruck entsteht, dass schon ein Gespräch oder eine E-Mail verdächtig sind. Menschen, die Kontakte zu Journalisten pflegen, werden durch Staatsanwaltschaften in die Nähe von Kriminellen gerückt.
– Die Recherche wird schwieriger. Durch ein Klima der Angst und Verunsicherung sind weniger Menschen bereit, mit Journalisten zu sprechen.
– Journalisten werden ausgegrenzt. Der Zugang zu Menschen in der realen Welt ausserhalb der Redaktionsräume wird weiter eingeschränkt. Schon heute bewegen sich viele Journalisten in einer Parallelwelt, die von PR-Menschen unterhalten wird. Nun droht der alltägliche, niederschwellige Austausch mit der «Basis» gänzlich wegzubrechen.
Doch was soll eine Journalistin, ein Journalist nun tun? Es kann nicht sein, dass sich unser Gegenüber bereits in einem Verhörraum der Stadtpolizei Zürich wähnt, wenn es eine Tages-Anzeiger-Visitenkarte in die Hand gedrückt bekommt. Ein wichtiger Grundsatz – eine Grundhaltung auch in redaktionsinternen Diskussionen – ist daher, im Alltag konsequent gegen die Stigmatisierung anzukämpfen. Der Kontakt mit einem Journalisten ist nichts Verwerfliches. Journalisten müssen wissen, was ist, bevor sie schreiben können, was ist.
Daneben sollten sich Journalisten auch an gewisse Regeln halten, um ihre Kontakte vor dem Zugriff einer wildgewordenen Staatsanwaltschaft oder eines übereifrigen Arbeitgebers zu schützen:
– Zurück zum persönlichen Treffen. Das ist sowieso viel angenehmer. Bei heiklen Sachen ein Muss.
– Falls ein Telefongespräch nötig ist: Benutzen Sie nicht Ihren eigenen Direktanschluss, sondern ein allgemeines Telefon auf der Redaktion. Die manuelle Rufnummerunterdrückung schützt nicht, wenn die Staatsanwaltschaft Verbindungsdaten anfordert.
– Wenn E-Mail-Korrespondenz nötig ist: Nur Unverfängliches besprechen, Brisantes in jedem Fall nur bei einem persönlichen Treffen. Falls Ihr Gegenüber eine private Adresse hat, verwenden Sie diese und raten Sie Ihrem Kontakt, private Nachrichten nur zu Hause abzurufen. Verwenden Sie auch nicht Ihre Redaktionsadresse, sondern eine private Adresse. In heiklen Fällen eine eigens eingerichtete unter einem Alias.
– Konsequenter «digitaler» Quellenschutz: Für den Fall, dass die Staatsanwaltschaft Ihre Geräte beschlagnahmt, müssen Sie sichergehen, dass Ihren Quellen keine Nachteile erwachsen. Kontakte also nicht auf dem Computer speichern. Verschlüsseln Sie Ihre Korrespondenz, löschen Sie nicht mehr benötigte Mails. Lassen Sie sich digitale Dokumente nur per Datenträger (USB-Stick, CD) überreichen. Bewahren Sie heikle Dokumente ausschliesslich als Ausdruck auf.
Die digitale Massen-Suchaktion der Staatsanwaltschaft Zürich zeigt einmal mehr, wie wichtig solche Massnahmen sind, gerade wenn es sich bei den Kontakten um Whistleblower handelt. Denn trotz miserabler Gesetzeslage und bissiger Staatsanwaltschaften trauen sich in der Schweiz mutige Menschen (noch!), Missstände aufzudecken, die andere lieber totschweigen.
Florian Imbach ist Vorstandsmitglied von investigativ.ch