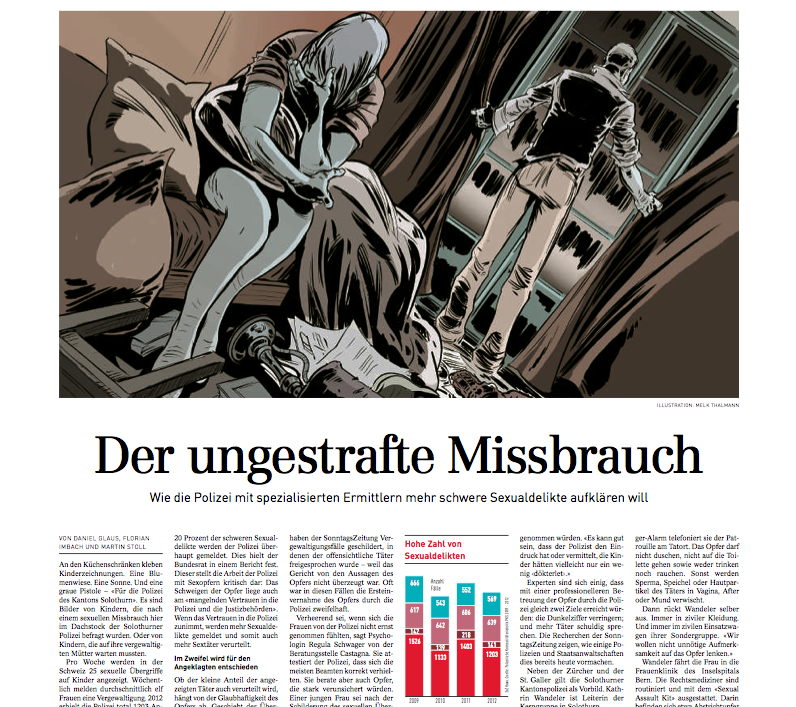
Erschienen in der SonntagsZeitung vom 28. April 2013
Von Daniel Glaus, Florian Imbach und Martin Stoll
An den Küchenschränken kleben Kinderzeichnungen. Eine Blumenwiese. Eine Sonne. Und eine graue Pistole – «Für die Polizei des Kantons Solothurn». Es sind Bilder von Kindern, die nach einem sexuellen Missbrauch hier im Dachstock der Solothurner Polizei befragt wurden. Oder von Kindern, die auf ihre vergewaltigten Mütter warten mussten.
Pro Woche werden in der Schweiz 25 sexuelle Übergriffe auf Kinder angezeigt. Wöchentlich melden durchschnittlich elf Frauen eine Vergewaltigung. 2012 erhielt die Polizei total 1203 Anzeigen wegen sexueller Handlungen mit Kindern und 569 wegen Vergewaltigung (siehe Grafik).
Die Anzeigen gemäss Kriminalitätsstatistik widerspiegeln allerdings nur rund ein Fünftel des wahren Ausmasses. Bloss circa 20 Prozent der schweren Sexualdelikte werden der Polizei überhaupt gemeldet. Dies hielt der Bundesrat in einem Bericht fest. Dieser stellt die Arbeit der Polizei mit Sexopfern kritisch dar: Das Schweigen der Opfer liege auch am «mangelnden Vertrauen in die Polizei und die Justizbehörden». Wenn das Vertrauen in die Polizei zunimmt, werden mehr Sexualdelikte gemeldet und somit auch mehr Sextäter verurteilt.
Im Zweifel wird für den Angeklagten entschieden
Ob der kleine Anteil der angezeigten Täter auch verurteilt wird, hängt von der Glaubhaftigkeit des Opfers ab. Geschieht der Übergriff unter Bekannten, steht es Aussage gegen Aussage – im Zweifel für den Angeklagten.
Dass wegen mangelhafter Polizeiarbeit Sexualstraftäter ungeschoren davonkommen, monieren mehrere Opferanwälte. Sie haben der SonntagsZeitung Vergewaltigungsfälle geschildert, in denen der offensichtliche Täter freigesprochen wurde – weil das Gericht von den Aussagen des Opfers nicht überzeugt war. Oft war in diesen Fällen die Ersteinvernahme des Opfers durch die Polizei zweifelhaft.
Verheerend sei, wenn sich die Frauen von der Polizei nicht ernst genommen fühlten, sagt Psychologin Regula Schwager von der Beratungsstelle Castagna. Sie attestiert der Polizei, dass sich die meisten Beamten korrekt verhielten. Sie berate aber auch Opfer, die stark verunsichert würden. Einer jungen Frau sei nach der Schilderung des sexuellen Übergriffs vorgehalten worden: «Wieso hätte er das tun sollen?»
Monika Egli-Alge, Leiterin des Forensisches Instituts Ostschweiz, kritisiert, dass manchmal sogar Meldungen sexueller Handlungen mit Kindern nicht ernst genug genommen würden. «Es kann gut sein, dass der Polizist den Eindruck hat oder vermittelt, die Kinder hätten vielleicht nur ein wenig ‹dökterlet›.»
Experten sind sich einig, dass mit einer professionelleren Betreuung der Opfer durch die Polizei gleich zwei Ziele erreicht würden: die Dunkelziffer verringern; und mehr Täter schuldig sprechen. Die Recherchen der SonntagsZeitung zeigen, wie einige Polizeien und Staatsanwaltschaften dies bereits heute vormachen.
Neben der Zürcher und der St. Galler gilt die Solothurner Kantonspolizei als Vorbild. Kathrin Wandeler ist Leiterin der Kerngruppe in Solothurn.
Hier ist 24 Stunden eine von neun speziell geschulten Polizistinnen auf Pikett. Für männliche Opfer stehen drei Beamte bereit. Während des siebentägigen Piketts rücke sie ein- bis zweimal aus, sagt Wandeler. Nach dem Pager-Alarm telefoniert sie der Patrouille am Tatort. Das Opfer darf nicht duschen, nicht auf die Toilette gehen sowie weder trinken noch rauchen. Sonst werden Sperma, Speichel oder Hautpartikel des Täters in Vagina, After oder Mund verwischt.
Dann rückt Wandeler selber aus. Immer in ziviler Kleidung. Und immer im zivilen Einsatzwagen ihrer Sondergruppe. «Wir wollen nicht unnötige Aufmerksamkeit auf das Opfer lenken.»
Wandeler fährt die Frau in die Frauenklinik des Inselspitals Bern. Die Rechtsmediziner sind routiniert und mit dem «Sexual Assault Kit» ausgestattet. Darin befinden sich etwa Abstrichtupfer zum Sicherstellen von DNA-Spuren sowie Verpackungsmaterial zur Aufbewahrung, damit die Spuren nicht mit fremder DNA kontaminiert werden.
Rechtmedizinerin Corinna Schön fotografiert Verletzungen wie Blutergüsse oder Schnittwunden und stellt fest, wann und wie diese zugefügt wurden.
In der gynäkologischen Untersuchung werden Verletzungen im Intimbereich festgestellt, und die Opfer werden auf Geschlechtskrankheiten getestet, nach Bedarf eine HIV-Prophylaxe oder Empfängnisverhütung eingeleitet.
Die ersten Aussagen sind zentral für einen Schuldspruch
Nach der rund zweistündigen Untersuchung bringt Polizistin Wandeler die Frau zum Polizeiposten in Solothurn. Den Dachstock im dritten Geschoss hat ihr Team vor über zehn Jahren für die Befragung von Opfern sexueller Gewalt eingerichtet. Man wähnt sich in einer Dachwohnung.
Die ersten Aussagen des Opfers sind nun zentral für einen Schuldspruch vor Gericht. Christoph Ill ist Staatsanwalt in St. Gallen und stellvertretender Leiter des Luzerner Kompetenzzentrums für Forensik und Wirtschaftskriminalität. Er sagt, die Qualität der ersten Einvernahme entscheide darüber, ob eine seriöse Aussage zur Glaubhaftigkeit des Opfers gemacht werden könne.
Denn bei vielen Sexualdelikten sagen die DNA-Spuren nur, dass ein sexueller Kontakt stattgefunden hat. Ob dieser gegen den Willen des Opfers war, bleibt offen. Um zu erhellen, was wirklich vorgefallen sei, müsse die Befragerin die Gabe haben, das Opfer zum Sprechen zu bringen, sagt Ill.
Henriette Haas, Professorin für forensische Psychologie an der Universität Zürich, die auch Polizisten und Staatsanwälte in Befragungstechnik schult, erklärt, weshalb die Befrager alles beim ersten Mal richtig machen müssen: «Man muss sich die Köpfe der Befragten als Tatort vorstellen. Polizisten dürfen dort so wenig eigene Spuren hinterlassen wie möglich, damit die Gedächtnisspuren später verwertbar sind.»
Psychologin Haas schildert eine typische Befragung, die keine verwertbaren Antworten liefert. Der folgende Dialog basiert auf Fällen aus ihrer Praxis und Lehrtätigkeit, wurde zum Schutz der Opfer aber verfremdet. Es geht um «Jasmin», eine 22-jährige Albanerin, die von ihrem Mann schwer misshandelt wird. Die Nachbarn melden sich bei der Polizei, die Jasmin anschliessend befragt.
Polizist: Ist Ihr Mann im Besitz von Waffen?
Jasmin: Nein.
Polizist: Hat er Sie jemals mit Waffen bedroht?
Jasmin: Nein, nur mit dem Brotmesser und gewürgt.
Polizist: Wie oft hat er Sie schon gewürgt, wurde Ihnen schwindlig oder fand ein Urin-Abgang statt?
Jasmin: Er legt seine Hände um meinen Hals und würgt, bis ich aufgebe. Er sagt, er könne mit mir machen, was er wolle, er könne ja wieder nach Albanien zurück, und dort kann ihm die Schweizer Justiz nichts machen. Er droht mich zu verstossen, ich könnte dann nirgendwo hin.
Polizist: Kam es zu Vergewaltigungen in Ihrer Ehe?
Jasmin: Nein, er ist ja mein Mann, ich wollte ihn nicht anzeigen. Er hat ja ein Recht auf ehelichen Verkehr. Er will Kinder, und ich möchte sie im Prinzip auch. Mehr kann ich in meiner jetzigen Verfassung nicht dazu sagen.
Psychologin Haas sagt, mit einer solchen Einvernahme könne man «schlichtweg nichts darüber sagen, was überhaupt passiert ist». Denn man wisse nicht, was das Opfer unter «Vergewaltigung» verstehe, das sei eine Worthülse.
Die Folge: Es entstehen Beweislücken. Deshalb wird der Beschuldigte trotz starker Indizien meist freigesprochen.
«Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass ein Fragekatalog runtergerattert wird und Mehrfachfragen gestellt werden», sagt Haas. «Eine Antwort auf eine vorgespurte Frage ist wenig glaubhaft. Man müsste darauf hinarbeiten, dass die Frau von sich aus die Taten genau benennt, etwa indem man sagt: ‹Erzählen Sie bitte nochmals ganz genau, was er gemacht hat, nachdem er Sie zu Boden drückte. Es ist wichtig, dass Sie sagen, was er mit welchem Körperteil mit Ihnen gemacht hat.›»
Staatsanwalt Ill ergänzt: «Es muss ganz klar rüberkommen, dass der Beschuldigte gegen den Willen des Opfers mit seinem Penis in ihre Scheide eingedrungen ist, nur das entspricht dem Tatbestand der Vergewaltigung.»
Sind Kinder Opfer sexueller Gewalt, ist die Einvernahme noch anspruchsvoller. Ein Fall im Kanton Nidwalden illustriert die Folgen einer falschen Kinderbefragung: Die gynäkologischen Gutachten liefern starke Hinweise auf mehrmaligen sexuellen Missbrauch eines vierjährigen Mädchens und seiner sechsjährigen Schwester, wahrscheinlich durch den Vater. In zweiter Instanz wird er freigesprochen. Befragt wurden die Mädchen von einer Therapeutin, die sich laut Gerichtsakten auf ihre «wahnsinnig starke Intuition und auf ihr Wissen um die Bildsprache» berief.
Im Urteil, das acht Jahre nach dem Gang der Mutter zur Therapeutin gesprochen wurde, schreiben die Richter, heute könnten juristisch verwertbare Aussagen vorliegen, wenn die Mädchen einer Fachperson für Kinderbefragungen bei sexuellem Missbrauch überlassen worden wären.
Wichtig ist, dass das Kind in eigenen Worten erzählt
Schweizweit am meisten Befragungen von Minderjährigen führt der Dienst Sexualdelikte/Kindesschutz der Kantonspolizei Zürich durch. Franziska Schubiger hat 16 Jahre Erfahrung als Ermittlerin von Sexualdelikten.
Im Befragungsraum für Kinder zeichnen zwei Videokameras das Gespräch auf, Mutter oder Vater bleiben meistens draussen. Im Raum nebenan sitzt eine speziell ausgebildete Psychologin. Sie überwacht das Gespräch auf zwei Bildschirmen und muss einschreiten, wenn das Kind zu stark belastet wird. In diesem Raum sitzt auch der Ermittler, der später den Beschuldigten befragt.
Schubiger sagt, die erste, rund zweistündige Befragung sei entscheidend für die Aufklärung. «Die Befragungen sind intensiv. Kinder haben zum Beispiel oft noch gar keine Worte für Geschlechtsteile.» Wichtig sei, dass das Kind in eigenen Worten erzähle, was passiert ist, sagt Schubiger. «Ich beginne mit allgemeinen Fragen, zum Beispiel, was es gerade im Kindergarten mache, und komme dann nach und nach auf das Delikt zu sprechen.»
Was heute bei der Befragung von Kindern gesetzlich vorgeschrieben ist – dass ausschliesslich Fachpersonen zum Einsatz kommen –, soll auch für erwachsene Opfer schwerer Sexualdelikte gelten, findet Susanne Nielen, Leiterin der Beratungsstelle Opferhilfe Aargau/Solothurn und Fachhochschul-Dozentin.
«Wenn schon jemand den Mut aufbringt, ein Sexualdelikt anzuzeigen, so muss sichergestellt sein, dass die Person eine professionelle Betreuung erhält, unabhängig davon, wo sie sich meldet», so Nielen. Nur so kann, wie vom Bundesrat gefordert, die Dunkelziffer reduziert und können mehr Sextäter überführt werden.